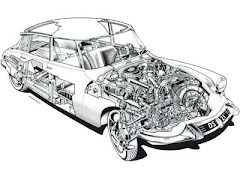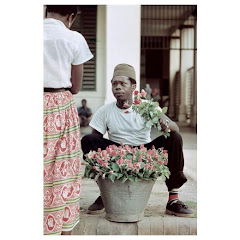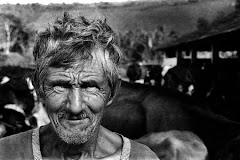Ratschläge für die Sorge um Sich.
Ratschläge für die Sorge um Sich.von Lennart Laberenz
Einer der scharfsichtigsten Analysten moderner Politik – Niccolò Machiavelli nämlich – verwendete eine doppelte Semantik, wenn es bei ihm um den Begriff „des Guten“ ging. In einem radikalen Bruch mit der mittelalterlichen Blick auf Geschichte, sieht er sie nun nicht mehr als providentia Dei sondern zu einem Gutteil als Frucht individueller Handlungen. Die necessità, also die historischen Gesetzmäßigkeiten treten auf den Plan. Die eine Hälfte der Handlungen hänge demnach „frei vom Schicksal ab, die andere aber oder etwas weniger sei unserem freien Willen überlassen”.
Nun ist die handelnde Person – Machiavelli geht vom allein herrschenden Fürsten aus – gezwungen ein doppeltes Gutes um zum bonnum commune zu gelangen: Auf der einen Seite steht die Moral, die der Fürst selbstverständlich zu beachten hat. Dem entgegen kann die necessità Umstände präsentieren, die den Fürsten zwingen, sie zu verletzen. In diesem Fall habe die handelnde Person unbedingt das zweite Gute zu befolgen, die Absicherung des eigenen Erfolges, die Stabilität des Fürstentums, sich selbst also.
Das Staatserfordernis nötigt den Fürsten „oft Treue und Glauben zu brechen und der Menschenliebe, der Menschlichkeit und Religion entgegenzuhandeln. Er muss also nach dem Winde segeln, aber nicht ganz vom Wege des Guten ablenken, solange dies nur möglich ist; erst dann muss er ohne Bedenken Verbrechen begehen, wenn es die äußerste Not erfordert,” schreibt Machiavelli. Bei Machiavelli wird das Ziel seiner Ratschläge an den Fürsten unmissverständlich klar, es geht um die Stabilität – und damit offenbart er gleichsam die Elle, an der man ihn messen müsse.
Ratschlagebücher und Erziehungsliteratur werfen gleichsam notwendig die Frage nach ihrer Legitimität auf, wir fragen automatisch, was passiert, wenn wir das Gelesene in die Tat umsetzten. Eines der erfolgreichsten Ratgeber des Sommers ist Adam Soboczynskis ‚Die schonende Abwehr verliebter Frauen’. Ob Soboczyncski dabei eine literarische Variante der Anleitung zum Erfolg, oder erfolgreiche Literatur verkleidet als Verhaltens-Anleitung geschrieben hat, sei dahingestellt. Das schmale Büchlein liest sich flott, Soboczynski konstruiert Fälle, aus denen er Verhaltensmuster destilliert und schließlich mit je einer „Maxime“ versieht. „Anja zum Beispiel,“ heißt es dann und man kann schmunzeln.
Überhaupt ist das Schmunzeln – die ironische Halbdistanz Tonlage. Was aber beim Machttheoretiker Machiavelli klar ist, fehlt bei Soboczynski, oder wird nur indirekt genannt. Was passiert also, wenn wir ihm folgen? Was ist also gut? Nun, wir wären erfolgreich, weil wir eine ausgeklügelte Sorge um uns selbst betreiben. Wir würden blenden, wie alle anderen auch, wir würden tricksen und täuschen, andere aufs Glatteis führen und für uns die Kuh vom selben. Dabei bestünde das Gute im Erfolg und der Erfolg also nur auf den ersten Blick in der schonenden Abwehr verliebter Frauen. Wir nähmen auch gleich noch die Hübschen und Erfolgreichen mit, behielten unseren Job, oder würden unseren Chef beerben, wenn wir nicht als Selbstständige schließlich sowieso den anderen haushoch überlegen wären.
Man kann Adam Soboczynski also als ratgeberisch verbrämte Analyse lesen, in der es im Wesentlichen um den Mehrgewinn im Selbstausbeutungswettlauf geht – durch allerlei Formen der Disziplinierung. Soboczynski weist damit vor allem jedoch auf die Selbstabsorbiertheit derjeniger, die heute als Lektoren, Autoren, oder Architekten (so das wiederkehrende Personal seiner exemplarischen Anekdoten) gewagte Entwürfe und sonstiges kreatives Leben produzieren. Und da verlieren sich die Spuren des Guten.
Interessant ist: diese Menschen – medial überpräsent, weil sie die Medien oft selbst machen – weisen in keinem Moment über sich hinaus, verfolgen als einzige Idee sich selbst und leben folgerichtig in einer Welt, die bedrückend eng aus den Fragen beruflicher Entwicklung, den Möglichkeiten des nächsten Beischlafs und vielleicht der im Grunde spießigen Suche nach einer erfolgreichen Partnerschaft gezimmert ist. Deshalb kontrollieren sie ihre Affekte, halten sich mit überhasteten Grobheiten per Mail und selbst im Anschluss an grobe Witze angriffslustiger Chefs oder Konkurrenten zurück, bevorzugen die „mäßige Entfernung“ zu der schon Schopenhauer riet.
Soboczynski charakterisiert einen Krieg Aller gegen Alle unter den gehegten Bedingungen der glasstählernen Großraumbüros. Allerdings beginnt das Büchlein sich etwa knapp unterhalb der Mitte (Kapitel 14 „Alle blenden“) zu ziehen. Die sprachlichen Zirkulärreisen, indem immer andersnamige Personen einander berührende Geschichte aus unterschiedlichen Blickwinkeln erleben, wirken etwas bemüht. Und da nicht viel Neues passiert, fragt man sich irgendwann, warum nebenfigürliche Juristen und Anwälte immer „aufgeräumt“ sind, wie viele Kaffeehaustischchen dazu einladen die Köpfe zu verschränken und warum die Vorliebe bestimmter Kreise auf immer dem gleichen Bordeaux Saint Estèphe liegt. Es ist vielleicht so, dass die Position des ewigen Schmunzeln irgendwann zäh wird, man fragt sich, worüber der Autor denn nun grinst, vor allem da das Personal der kleinen Anekdoten eher Fades erlebt und von sich gibt. Banales hören wir schließlich zum Thema Kleidung und Körperumfang und hintenraus zerfasern die Geschichten ein wenig. Ein wenig, wie ein Latte Macchiato, der zum Ende lauwarm und indifferent wird.
Machiavellis Vorschläge aus dem Principe haben Unterschiedliche unterschiedlich gelesen. Noch immer gilt er als einer der Begründer der Arcana imperii und „dunkler Schriftsteller des Bürgertums“ (Jürgen Habermas). Den hübsch gestaltete Band aus der maladen Aufbau-Verlagsgruppe liest sich eher nebenbei und recht behände – es bleibt kein auffälliger Nachgeschmack. Nur im Stillen wünschen wir uns eigentlich, dass es noch viele Menschen gibt, die sich dem disziplinären Regime der vollkommen in der Sorge um sich selbst absorbierten Welt nicht unterordnen. Denn vielleicht haben sie dann etwas, was wir auch gut finden könnten.
Adam Soboczynski, Von der schonenden Abwehr verliebter Frauen. G. Kiepenheuer Verlag. 2004 Seiten, 18,95 Euro.