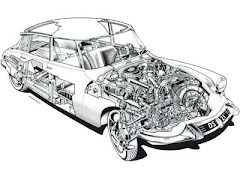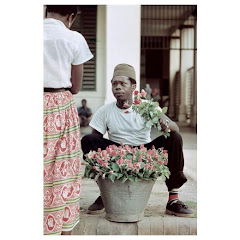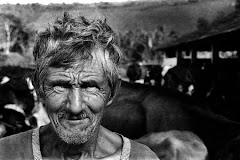von Lennart Laberenz
„Vorher war ich glücklich, zufrieden und dumm,“ sagt Geirr. Nun ist nachher, Geirr ist durch einen Unfall von Hüfte abwärts gelähmt und verbittert. Die Unfallversicherung hat ihm und seiner Frau Ingvild ein hübsches Häuschen irgendwo im seenahen, grünen Stadtumfeld einer norwegischen Stadt bezahlt, doch geholfen hat es nicht. Im Gegenteil: Geirr hat sich zurückgezogen in eine Welt aus Kriegsfilmen, allerlei Flüssigem und Rauchbarem, einem schicken Revolver und Johnny Cash. Aus dieser heraus setzt er auch die gezwungen-geduldigen und stets auf das Positive zielenden Therapiebemühungen von Tori außer Kraft. Zunächst mit dem Feuerlöscher, dann mit gepflegten Pöbeleien und schließlich mit einem trockenen Faustschlag.
Ingvild hatte Tori und ihre Gruppe, die an einem bunten Strauß von Gebrechen leidet, eingeladen, teils um ihre Ehe zu retten, mit ihrer eigenen Hilflosigkeit umzugehen und vielleicht, um ihr Gewissen zu entlasten. Von nun an zerfällt die starre Komposition des Positivdenkens, mit der Tori sorgfältig, jeden einzelnen ihrer Patienten zum Glücklichsein verdammt hatte. Der Blick wird stückweise frei auf Seelenlandschaften, in denen sich Eigensinn, Frustration, Gewalt, Sexualität, oder Einsamkeit wieder an die Stelle des fein gehäkelten Kotztütchens (vormals verwendet zum metaphorischen Ausspucken der negativen Gedanken) treten. Die Gruppe findet gleichsam dialektisch zueinander, indem sie lernt, laut >Scheiße< face="arial">
Bård Breien zielt mit der melancholischen Komödie – die nie in komödiantenhaftem erstickt, sich allenfalls gelegentlich selbst durch überflüssige Musik ein Bein stellt – auf das Wohlwollen und das schlechte Gewissen, mit dem die Gesellschaft Behinderte umhäkelt und neutralisiert. Denn unter der Hand stöhnt sie ja auch gleichzeitig über die Belastung durch die Krüppel. Geirr (angenehm ungekünstelt: Fridjov Saheim) streckt mit dem Faustschlag also zielgerecht Schopenhauers Mitleidsethik nieder, die mit der Sorge um den Anderen die Sorge um sich meint. Er trifft den zutiefst protestantischen Versuch, persönliche Katastrophen zum Guten umzutherapieren, um alsbald zumindest neutral im Leistungskonzert der Gesellschaft wieder mitzutun, grade und hart am Kinn. Breien scheut das eine oder andere Klischee nicht und wird dabei wunderbar unterstützt von seinen Schauspielern, sowie einer herrlich unprätentiösen und sehr ausgefeilten Bildregie (Gaute Gunnari). Der einzige Wehrmutstropfen des Films ist ihm selbst selbst somit gar nicht anzulasten: Eine deutsche Filmförderung würde diese Geschichte bestimmt bereits im Keim ersticken.
Ab 18. September im Kino.