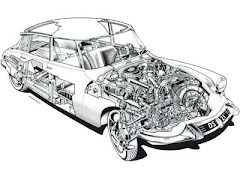Pulitzerpreisträger Junot Díaz über einige Themen seines Debütromans: Emigration, große Busen, starke Frauen und Sex.
Mit Díaz sprachen Lennart Laberenz und Philipp Lichterbeck.
Junot Díaz: Bilderbuchkarriere vom Einwanderer zum Literaturstar. Für seinen Debütroman "Das kurze wundersame Leben des Oscar Wao" erhielt er den Pulitzerpreis.
Zur Person:
Geb. 1968 in der Dominikanischen Republik; immigrierte als Kind in die USA. Erzählband "Abtauchen" (1996). Pulitzerpreis für den Debütroman "Das kurze wundersame Leben des Oscar Wao" (2007).
Standard: Sie scheinen große Freude daran zu haben, weibliche Körper zu beschreiben. Bei Ihren Lesungen tragen Sie oft die Szene vor, in der Tochter Lola den enormen Busen ihrer Mutter Belicia abtastet ...
Diaz: ... und es kommt heraus, dass sie Brustkrebs hat. Ich schildere die Brüste als etwas Schönes, aber sie sind von Krankheit befallen. Es ist der Terror, der die Menschen fasziniert, nicht das Glück.
Standard: Und über die junge Belicia schreiben Sie, ihre "tetas" seien von solch titanischen Ausmaßen, dass jeder heterosexuelle Mann sein Leben neu überdenke.
Diaz: Ich werde oft beschimpft, weil ich angeblich Frauen sexualisiere. Doch ich reproduziere die hypersexualisierte US-Kultur, diesen Körperkult, der dazu führt, dass der Körper als Ausdruck der Persönlichkeit eines Menschen betrachtet wird.
Standard: Leiden die männlichen Charaktere in Ihrem Roman eigentlich unter dem Mangel an Sex oder tun es nur zur Selbstbestätigung?
Diaz: Yunior, der Erzähler, ist ein Sportficker. Bei ihm gibt es weder Schmerz noch Konsequenzen noch Moral. In meinen Zwanzigern war ich ähnlich. Ich griff mir jedes Mädchen, das ich kriegen konnte, und habe alle meine Freundinnen betrogen. Ich habe noch nie einen jungen Mann getroffen, der nicht wie ein Verrückter bumsen wollte. Man muss aber ein ziemlicher Depp sein, um das sein ganzes Leben lang durchzuziehen.
Standard: Die Frauen sind im Roman die Stärkeren. Reflektiert das die Erfahrung der dominikanischen Einwanderung?
Diaz: Männer bekamen seltener ein Visum, daher gibt es unter dominikanischen Immigranten viel mehr Frauen, die ein Geschäft führen und arbeiten. Das hat starke Frauen hervorgebracht.
Standard: Sie sind als Kind mit Ihrer Familie in die USA immigriert.
Diaz: Alle waren dabei: Großmutter, Mutter, zwei Tanten, zwei Schwestern, zwei Brüder und mein Vater. Die Familie ist stark vom Militär geprägt. Mein Vater war in der Armee. Ein Schwager ist Panzerfahrer, mein kleiner Bruder ein Marine, beiden Neffen sind im Irak. Gleichzeitig gab es immer diese grimmigen Frauen.
Standard: Grimmig?
Diaz: Meine Mutter etwa. Arbeitete ihr ganzes Leben in verschiedenen Fabriken, kümmerte sich um fünf Kinder. Sie konnte absolut keinen Quatsch ausstehen. Als sie herausfand, dass mein Vater fremdging, schmiss sie ihn raus. Wir haben nie wieder von ihm gehört. Sie sprach kein Englisch, hatte kein Auto und bekam keinen Cent Unterstützung. Meine Mutter ist heute 70 Jahre alt und arbeitet als Altenpflegerin.
Standard: Das scheint nicht unbedingt das Umfeld, in dem Pulitzerpreisgewinner gedeihen?
Diaz: Ich hatte Glück. Jeder Einwanderer versucht aufzusteigen. Wenn es einer schafft, heißt das nicht, er habe mehr Talent. Ich wuchs mit Freunden auf, die schlauer waren als ich, härter arbeiteten. Der Unterschied: meine Mutter wurde nie ernsthaft krank, sodass ich mich nicht um sie kümmern musste. Ich hatte nie Probleme mit der Polizei. Wäre ich nur einmal mit Drogen erwischt worden, wäre es das für mich als Einwanderer gewesen, Ende im Gelände. Die Sterne standen nicht gegen mich.
Standard: Der "New Yorker" hat Sie zu einem der wichtigsten Schriftsteller des 21. Jahrhunderts ernannt. Wie geht man damit um?
Diaz: Den Großteil des Applauses bekomme ich nur, weil ich den Pulitzerpreis gewonnen habe. Ich gehöre zudem einer Identitätsgruppe an, die gerade noch komfortabel ist: Ich bin keine Frau, ich bin nicht zu schwarz, ich bin nicht schwul. Hätte eine schwarze homosexuelle illegale Einwanderin diesen Roman geschrieben, wäre alles viel schwieriger für sie geworden.
Standard: Der amerikanische Literaturmarkt ist immer noch dominiert von den alten weißen Männern?
Diaz: Sicher. Immer noch wird in den USA der magische Realismus als lateinamerikanische Folklore abgetan. Dabei muss man nur in New Jersey leben, um zu verstehen, was das ist. In den Köpfen der weißen Amerikaner wimmelt es von Engeln und Teufeln. Auch ihr Europäer mögt Barack Obama im Weißen Haus, aber in der Buchhandlung ist euch Philipp Roth lieber. (DER STANDARD, Print-Ausgabe, 27.3.2009)