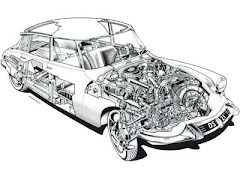Junot Díaz stammt aus der Dominikanischen Republik und wollte schon als Jugendlicher immer nur eins: schreiben. Nun ist er ein gefeierter Schriftsteller.
Ein Porträt von Lennart Laberenz und Kai-Philipp Lichterbeck
Im Berliner ArteKunsthotel sitzt Junot Díaz und reibt etwas verschlafen an seiner Brille. Er ist kein Mann langer Vorspiele oder überflüssigen Small Talks. Seine Zeit ist kostbar. Kaum fängt er an, über seinen gewaltig erfolgreichen Debütroman Das kurze wundersame Leben des Oscar Wao zu sprechen, bricht in der stillen Lobby das Chaos aus. Arbeiter wuseln, Leitern scheppern, die Kaffeemaschine raspelt. Doch so einfach ist Díaz nicht aus der Ruhe zu bringen, auch die Interviews sind Routine – seit Monaten trifft er Journalisten auf seiner Lesereise.
Dabei waren Lesungen, literaturwissenschaftliche Kolloquien und Empfänge nicht unbedingt zu erwarten: Schon am Abend zuvor hatte er mit verschmitztem Lächeln vor einem Publikum im Babylon erzählt, dass nichts in seiner Biografie auf eine erfolgreiche Schriftstellerkarriere hingewiesen hatte. Mit sechs Jahren wanderte er aus Santo Domingo nach New Jersey aus, lebte mit seiner Familie in jener Vorstadtarmut, die einen Teil der Tristesse der USA ausmachen. Working poor, wie er sagt. "Meine Mutter hat meinem Vater den Laufpass gegeben, als er sich eine Freundin zulegte. Da konnte sie kaum ein Wort Englisch, hatte kein Auto, aber fünf Kinder und kannte sich in New Jersey kaum aus." Einer der seltenen Momente, in denen sein Lächeln zerrinnt. Die alte Dame arbeitet immer noch als Altenpflegerin und habe extrem kräftige Oberarme, sagt er. Sie ist siebzig Jahre alt.
Díaz selbst lief als Kind beharrlich kilometerweit zur nächsten öffentlichen Bibliothek, blieb sogar der Schule fern, weil er an Weltraumopern und Science-Fiction-Werken schrieb. Ein Nerd war er und doch nicht so weltabgewandt wie Oscar, sein Titelheld. Zunächst wollte Díaz wie sein Vater zum Militär, er lieferte Billardtische aus, sein Rücken schmerzt noch heute. Er dachte an eine akademische Karriere, aber dann sei er eines Morgens aufgewacht und habe gedacht: "Das Einzige, was ich wirklich mag, sind Filme und Bücher. Vielleicht also sollte ich da etwas machen."
Und es habe auch strukturelle Aspekte gegeben, die seine Schriftstellerkarriere als eingewanderter Dominikaner erleichtert habe. "Ich bin nicht sehr schwarz, ich bin keine Frau und ich bin nicht schwul. Drei dicke Pluspunkte." Außerdem, in den USA unter Einwanderern ein enorm wichtiger Aspekt: "Wenn ich mit Kumpels unterwegs war, die Drogen dabei hatten, oder anderen Unfug machten, bin ich nie von der Polizei erwischt worden. Ich konnte mich ungestört entwickeln."
Schon der Vorgänger von Oscar Wao wurde in den USA hoch gelobt. Eine Sammlung von Kurzgeschichten, die in Deutschland 1997 unter dem Titel Abtauchen erschien. Für seinen Debüt-Roman erhielt der 40-jährige Díaz im vergangenen Jahr den Pulitzer-Preis. Als gäbe es Hip-Hop nicht, als sei der Slang seiner Romanfiguren seine Neuerfindung, jubeln nun die Kritiker, schwärmen vom einem "neuen Sound", dem "brodelnden Leben", der "Energie" und erheben Díaz zu einer der "unwiderstehlichsten Stimmen der Gegenwart".
Díaz grinst, seine Augen werden zu schmalen Schlitzen, er fährt sich mit der Hand durch das Bärtchen. "Eigentlich bin ich in der Dominikanischen Republik immer von den Intellektuellen verschmäht worden", sagt er, "bis ich den Pulitzer bekam." Vor Kurzem eröffnete Díaz einen hochoffiziellen Empfang in Santo Domingo mit den Worten: "Jetzt liebt ihr mich alle, was?" Er kann sich kaum retten vor Versuchen der Vereinnahmung: In den USA verkörpert er den amerikanischen Traum, in der Dominikanischen Republik ist er nunmehr per Parlamentsbeschluss "Kulturbotschafter". It’s fucked up, sagt er.
Die Geschichte des Oscar Wao ist eine Familiensaga. Sie folgt einer einst angesehenen Familie, die vom Diktator Trujillo ins Gefängnis und ins Exil getrieben wird. Was mit Oscars Großvater, dem Arzt Abelard Luis Cabral, begann, wie wir in der antilinear geknüpften Erzählung freilich erst viel später erfahren, was mit Großmüttern, Cousinen und Töchtern weiterläuft, endet am Beginn des Romans: In der postindustriellen Einöde New Jerseys erzählt Díaz’ literarisches Alter Ego Yunior die Familiensaga von Oscar, einem Nerd, dem alle fundamentalen dominikanischen Qualitäten (das wären: Frauen, Sport, Frauen, Coolness und Frauen) konsequent abgehen.
Díaz’ Figuren schwanken zwischen Leid, Sex und Qualen. In den USA, "wo es erheblich weniger kulturelle Erziehung gibt", wie Díaz rasch einwirft, wird er gelegentlich dafür kritisiert, dass er besonders seine weiblichen Romanfiguren sexualisiere. "Mich fasziniert diese hypersexualisierte Kultur in den USA. Nirgendwo sonst wird der Körper derart mit Bedeutung aufgeladen. Er wird wie besessen untersucht und kartografiert und gilt als Ausdruck der Persönlichkeit. Es ist fast wie im 19. Jahrhundert, als die Physiognomie als Wissenschaft galt."
Inzwischen lehrt er am angesehenen Massachusetts Institute of Technology und ist kein zwanghafter Schriftsteller. Seine Geschichten kosten ihn Kraft und viele Entwürfe, die er immer wieder neu betrachtet und verwirft. Zwischen seinem ersten Buch und dem Roman liegen elf Jahre. "Ich kann gut einige Tage oder Wochen ohne Schreiben verbringen", sagt er. Was kommt als Nächstes? Díaz lacht. "Ich möchte eine Liebesgeschichte schreiben. Eine Liebesgeschichte in den USA im letzten Jahr ihrer Zukunft."